"Eremitage-Ofen" um 1870
Rheinböllerhütte/Rheinböllen
Als streng gegliedertes Flächenkunstwerk ausgeführter, spätbiedermeierlicher Repräsentationsofen in rechteckiger Grundform. Schwerer, durchbrochen gearbeiteter, einteilig gegossener Fußsockel mit stabrandgefasstem, offenem Rautenmuster und eingefügten, blattverzierten Maskarons. Ebenfalls einteilig hergestellter, flächenoffener, leicht zurückspringender Brennkammerunterbau in maureskem Stil mit separatem Brennraumboden, tiefergelegtem Aschenkastentopf und doppeltem Tafelrost. Flacher Brennraum mit seitlicher Feuerungstüre und frontseitig rautenmusterumgebenem, kartuschengefasstem Bildmotiv eines flötenspielenden Hirtenknaben und seiner Herde.
Vierteilige, hohe Mantelpartien mit üppiger Kassettenornamentik, Spiralrankenleisten und figürlichen Flachreliefs. Kochkammerflügeltüren mit zierrahmengefassten Motiven von Bauer und Bäuerin, in den durchbrochenen Warmhaltekammertüren geflügelte Genien. Muschelgefasste Nischen mit griechischer Schicksalsgöttin sowie Pallas Athene. Leicht ausladender, verzierter Gesimsrahmen mit umlaufender, niedriger Flechtwerksgalerie.
Bei der als Urhebernachweis ausgeführten Buchstabenanordnung "E.OFEN.N.4.C.P.DEC." steht „E.“ für „Eremitage“, „C.P.“ für Christian Plock (1809-1882). Als Schüler und Nachfolger Conrad Weitbrechts (1796-1836) in der Rolle des „Kunsthandwerkers“ im Hüttenamt Wasseralfingen verfügte Plock bereits über ein umfangreiches künstlerisches Repertoire. Bei dem von der Rheinböllerhütte gefertigten Ofen handelt es sich demnach um einen „Lizenzguss“.
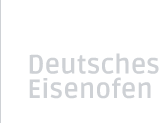
Sammlung
Copyright 2014-2023 | Deutsches Eisenofenmuseum | Karin Michelberger & Wilfried Schrem | Impressum & Datenschutz



