„Regulirofen“ um 1880
Rothehütte, Hohegeiß/Harz
Klassischer Stubenofen für langflammige Brennstoffe in polygonaler Grundform und vertikaler Gliederung. Einteilig gegossener Aschenkastensockel auf schwerer Bodenplatte mit leicht ausgestelltem, niedrigem Fußwerk. Hoher, vierteiliger Brennraum mit separat über Eck gesetzten, bandartigen Blattverzierungen zwischen unterem und oberem Übergangsrahmen. Schlanke, mehrteilige Warmhaltekammer zwischen ebenfalls einteilig gegossenen Querschächten mit durchbrochen gearbeiteter Rundbogentüre in erhabener Grundform über auffälliger Fächerkonsole. Flächendeckende, meist stabrandgefasste Roll-, Schweif- und Rautenverzierungen. Einteilig gegossenes Abschlusselement mit separat aufgesetzten, konturübergreifenden Kronenteilen in Blattform.
Für die in ihren Anfängen vermutlich bis ins 14. Jahrhundert zurückreichende Entstehungsgeschichte der Rothehütte ist der Hochofenbetrieb mit Holzkohle bis 1925 nachweisbar. Die ab 1707 als staatseigener Betrieb zunächst den Herzögen von Hannover unterstellte Eisenhütte gehörte ab dem Wiener Kongress von 1814 bis zur Annexion durch Preußen im Jahre 1866 zum Königreich Hannover. In diesen Zeitraum fällt auch das Wirken von Friedrich Ferdinand Splittgerber, einem in Berlin ausgebildeten akademischen Bildhauer. Als Modelleur schuf er zwischen 1830 und 1870 zahlreiche Ofenmodelle, nicht nur für die Rothehütte. Splittgerbers Jahresgehalt von 400 Reichstalern mussten die drei Königlich Hannover’schen Eisenhütten - Rothehütte, Königshütte und Sollingerhütte - gemeinsam erbringen. Vergleiche diesen Ofen.
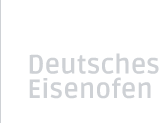
Sammlung
Copyright 2014-2023 | Deutsches Eisenofenmuseum | Karin Michelberger & Wilfried Schrem | Impressum & Datenschutz



